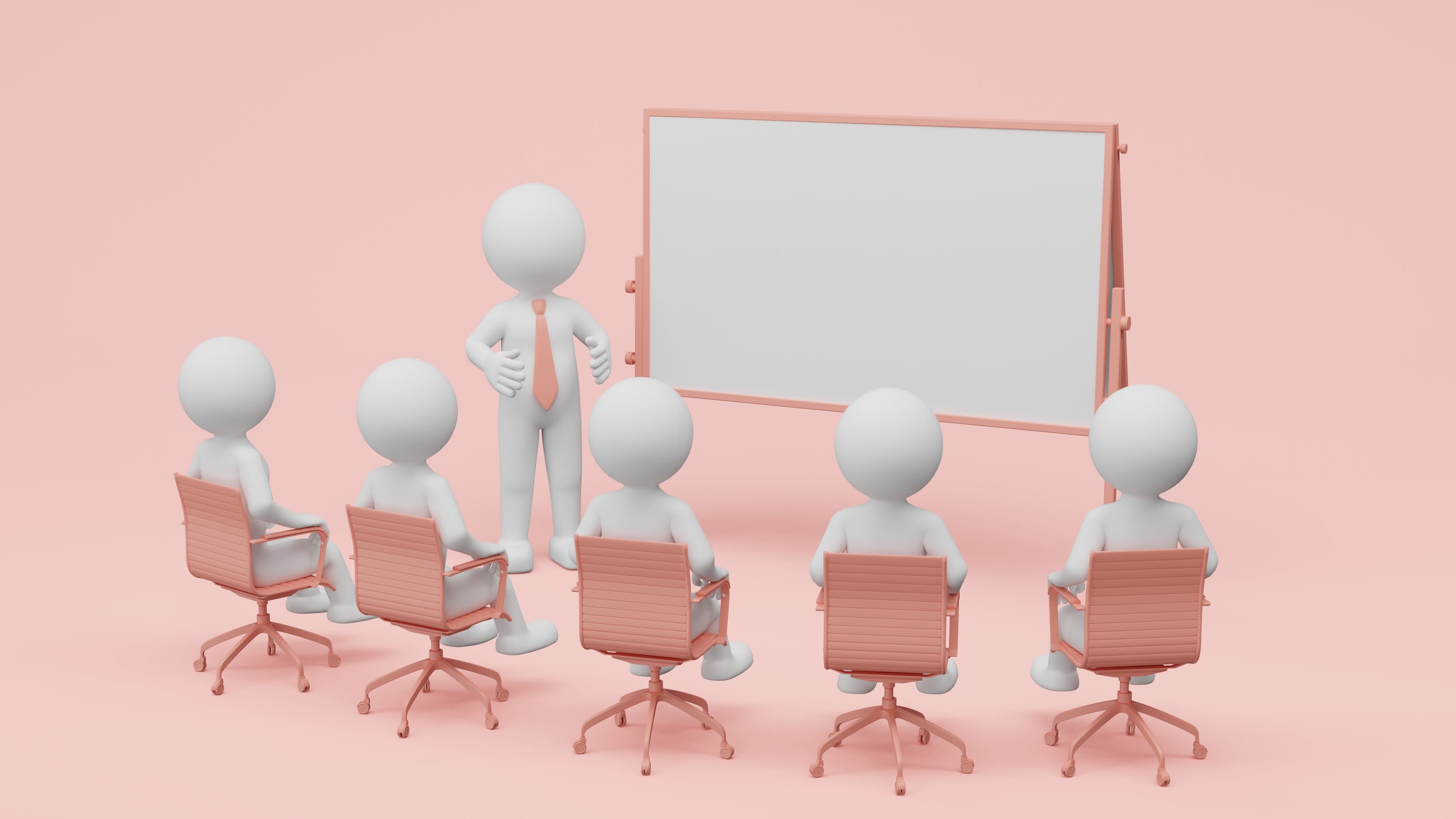Geld in der Literatur
Eine Rundreise mit Beispielen
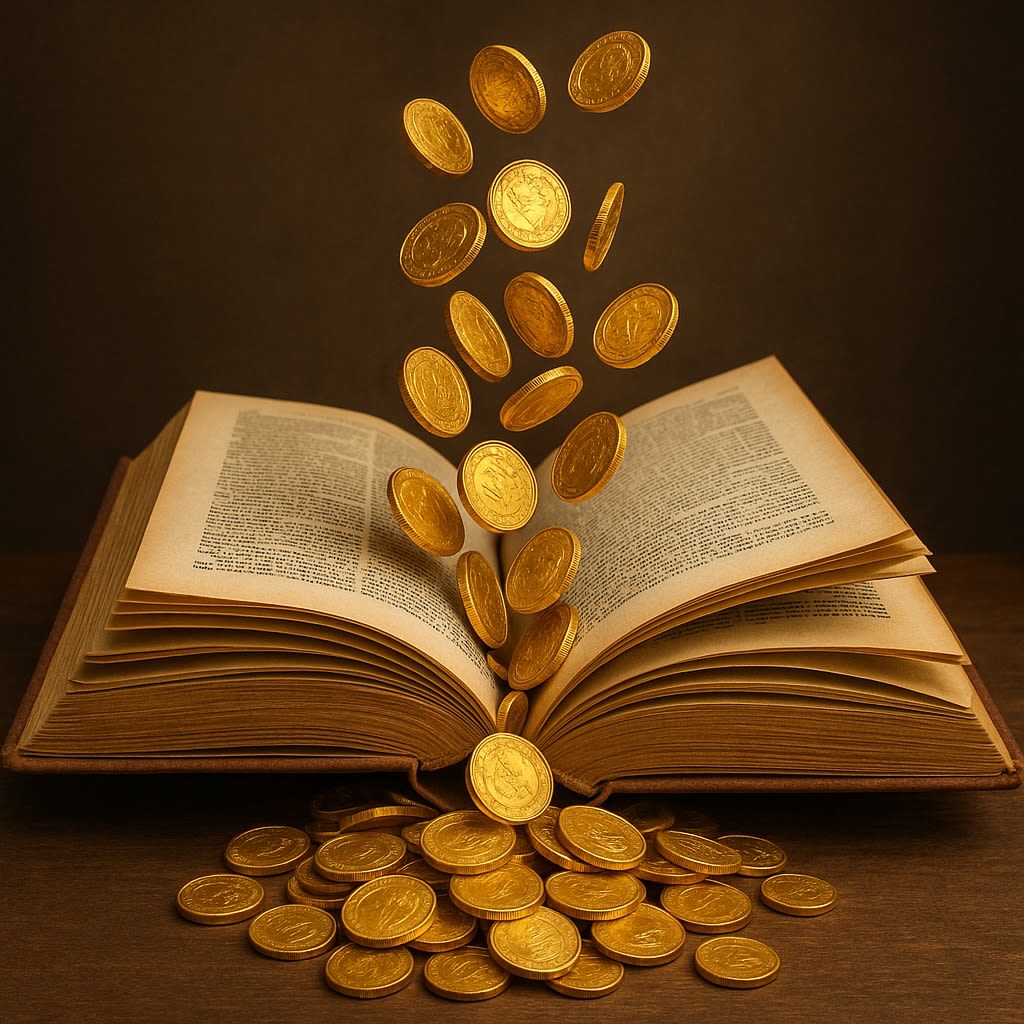
Haben Sie sich das auch schon mal gefragt: Was ist Geld eigentlich? Wir alle tun ja gern so, als wüssten wir's. Zahlen, Scheine, Zahlen auf dem Bildschirm -- oder? Aber was, wenn alles, was wir über Geld zu wissen glauben, nur eine gut erzählte Geschichte ist? Eine Fiktion?
Heute nehmen wir diese Geschichte mit Hilfe der Literatur auseinander. Denn Romane, Dramen und Volksbücher erzählen oft mehr über das Wesen des Geldes als Wirtschaftstheorien.
Fangen wir mit dem an, was Geld uns verspricht: Reichtum, Freiheit, Macht. Schon im alten Volksbuch „Fortunatus" von 1509 bekommt der Held die Wahl -- endlose Weisheit oder einen Geldbeutel, der sich niemals leert. Fortunatus denkt nicht lang nach: her mit dem Beutel! Klingt logisch -- wer braucht schon Weisheit, wenn er alles kaufen kann? Das ist die Urfantasie vom Reichtum ohne Mühe.
Fortunatus
Aber dann kommt der Realitätscheck -- zum Beispiel mit dem Klassiker „Der reichste Mann von Babylon". Da heisst es: Leg mindestens ein Zehntel von allem, was du verdienst, zur Seite, sofort. Dann, Regel 2 Behalte die Kontrolle über deine Ausgaben. Klingt simpel, ist aber entscheidend. Drittens: Lass dein Geld für dich wirken, also investiere dein Erspartes klug. Und zu guter Letzt, Regel Nummer 4 Werde immer besser in dem, was du tust, um eben auch mehr verdienen zu können. Das ist sozusagen der Gegenentwurf zur Magie, der disziplinierte echte Weg zum Wohlstand. Da gibt's keine Magie, nur eiserne Disziplin.
Bei Max Frisch geht's ums grosse Thema Identität. In „Stiller" (1954) steht der Protagonist -- ein Mann, der seine Vergangenheit verleugnet und behauptet, „Ich bin nicht Stiller" -- exemplarisch für den Kampf um Identität. Stiller will sich der Rolle entziehen, die andere ihm zuschreiben: Ehemann, Künstler, Schweizer Bürger. Er versucht, durch das Spiel mit Identitäten frei zu werden. Doch der Versuch scheitert: Die Gesellschaft, das Rechtssystem, die Sprache selbst -- alles zwingt ihn zurück in die alte Form. „Ich bin Stiller" wird zum Bekenntnis seiner Niederlage, aber auch zu einem Moment der Erkenntnis: Identität ist nicht frei wählbar, sondern entsteht im Spiegel der anderen.
In „homo faber" (1957) ist die Entwicklung fast spiegelbildlich: Walter Faber kämpft nicht mehr um Identität -- er funktioniert. Als rationaler Techniker hat er sich mit der ihm zugedachten Rolle abgefunden. Er lebt nach den Prinzipien der Vernunft, der Effizienz, der Kontrolle. Doch gerade diese selbstgeschaffene Rationalität wird zur Falle: Sie verdrängt das Emotionale, das Zufällige, das Lebendige.
Doch Geld hat auch seine dunkle Seite. Friedrich Dürrenmatt zeigt sie in „Der Besuch der alten Dame". Da kommt eine steinreiche Frau zurück in ihre Heimatstadt und bietet den Bewohnern ein Vermögen -- im Tausch für den Tod eines Mannes. Der Preis für ein Menschenleben: eine Milliarde. Und plötzlich wird klar: Alles hat einen Preis -- auch der Mensch.
Ähnlich finster geht's bei Bertolt Brecht zu. In „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny" darf man alles -- solange man's bezahlen kann. Das einzige Verbrechen dort? Pleite sein. Willkommen im Kapitalismus pur!
Und dann gibt's die Illusion vom Reichtum. Denken Sie an Mark Twains Million-Pfund-Note: Ein Mann hat einen Schein über eine Million Pfund, kann ihn aber gar nicht ausgeben. Trotzdem wird er wie ein König behandelt. Allein die Tatsache, dass er ihn hat, also die reine Wahrnehmung seines Reichtums, öffnet ihm jede Tür. Er gibt keinen einzigen Penny aus. Das beweist, die Illusion von Geld ist manchmal mächtiger als das Geld selbst.
Émile Zola treibt das noch weiter: In „Das Geld" beschreibt er die Pariser Börse als Bühne eines gigantischen Theaters -- Gewinne, Verluste, alles pure Fantasie. Geld wird hier zur Religion, die auf Glauben basiert, nicht auf Arbeit.
Etwa zur gleichen Zeit in Genf: dort erfasst Henri-Frédéric Amiel in seinem Journal intime dreissig Jahre lang sein Leben -- Seite um Seite. Hans Peter Treichler folgt diesen Aufzeichnungen und zeichnet ein eindrückliches Porträt des Gelehrten. Im Mittelpunkt: Amiels Verhältnis zum Geld -- eine faszinierende Ökobiografie aus dem Conzett Verlag.
Und dann kommt Jeremias Gotthelf mit seiner „Käserei in der Vehfreude". Schauen Sie sich diese Chronik des Scheiterns an. Jahr 1. Wir haben ein stabiles, traditionelles Dorf. Gemeinschaft zählt. Jahr 2. Eine moderne Käserei wird gebaut, die riesige Gewinne verspricht. Plötzlich geht es nur noch ums Geld. Jahr 3. Gier und Spekulation haben die alten Werte und die Moral komplett ersetzt. Und Jahr 4. Das ganze Ding bricht zusammen. Übrig bleiben wirtschaftliche und vor allem soziale Trümmer. Eine Warnung, die heute vielleicht aktueller ist als je zuvor.
Klingt nach 19. Jahrhundert? Von wegen! Heute sehen wir das wieder. J.D. Vance beschreibt in „Hillbilly Elegy" den amerikanischen Traum, der zum Albtraum geworden ist. Ganze Regionen bleiben zurück, Armut und Drogen breiten sich aus, während an der Wall Street die Zahlen tanzen. Der Traum vom Aufstieg? Für viele nur noch eine bittere Lüge. Eine Anklage des amerikanischen Vizepräsidenten - mit politischen Konsequenzen.
Und genau hier landen wir bei der entscheidenden Erkenntnis: Geld ist keine Naturkraft. Es fällt nicht vom Himmel wie Regen. Es ist, wie Eske Bockelmann sagt, eine Denkform -- ein menschliches Konstrukt, das wir selbst erschaffen haben.
Die Forderung, wie sie zum Beispiel auch im Umfeld von Norbert Koubecks Arbeit formuliert wird: Was es braucht, ist nichts weniger als eine Aufhebung von Geld als Denkform. Dieser Gedanke klingt utopisch. Aber er zwingt uns über die fundamentalen Spielregeln unserer Welt nachzudenken. Und genau das führt uns zur folgenden Frage. Wenn Geld wirklich nur eine Geschichte ist, die wir Menschen uns irgendwann mal ausgedacht haben, wer sagt dann, dass wir nicht auch eine andere schreiben können, vielleicht sogar eine bessere? Eine Geschichte, in der nicht Gier, sondern Gemeinschaft zählt?
weitere Beispiele