Geldlogik
12 Begriffe zum Thema Geld

Was erwartet Dich in dieser Lektüre?
Geld ist uns so nah, dass uns der Abstand fehlt, um es wirklich zu verstehen. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oder sag mal: Was ist Geld? Bevor Du ins Grübeln kommst, lies diesen Artikel, der Dir zwölf Aspekte erläutert. Stell Dir vor, Du gehst von dem Begriff Geld ein paar Schritte weg und umschreitest ihn im Uhrzeigersinn. An jeder Markierung einer vollen Stunde hältst Du an und schaust aus einem anderen Winkel auf diesen schillernden Begriff in der Mitte, jedes Mal zeigt sich Dir ein etwas anderes Bild.
Geld ist nicht nur Zahlungsmittel oder Wertspeicher, es beeinflusst uns Menschen grundlegend. Denn Geld hat nicht nur eine wirtschaftliche Seite, sondern auch eine soziale und sogar eine mentale Komponente. Damit Du ein so komplexes Phänomen erklären kannst, begleiten Illustrationen diesen Text und erläutern Dir die zwölf zentralen Aspekte von Geld. Wenn Du das Material gründlich durcharbeitest, beherrschst Du das Thema. Und dann bist Du dran: Erst wenn Du Dir Deine eigene Definition(en) formulierst, kannst Du wirklich über Geld reden!
Was kannst du von dieser Lektüre lernen?
- Du siehst, dass Geld mehr ist als nur Zahlungsmittel und Wertspeicher
- Du lernst Geld in seiner Gesamtheit erfassen. Du weitest Deinen Blick und Du lernst, dass Geld weit mehr ist als ein wirtschaftliches Phänomen ist.
- Am Ende erarbeitest Du Dir Deine eigene Definition, in Deinen Worten und mit dem Wissen, das Du Dir angeeignet hast – so bist Du bereit, auch anderen zu erklären, was Geld eigentlich ist
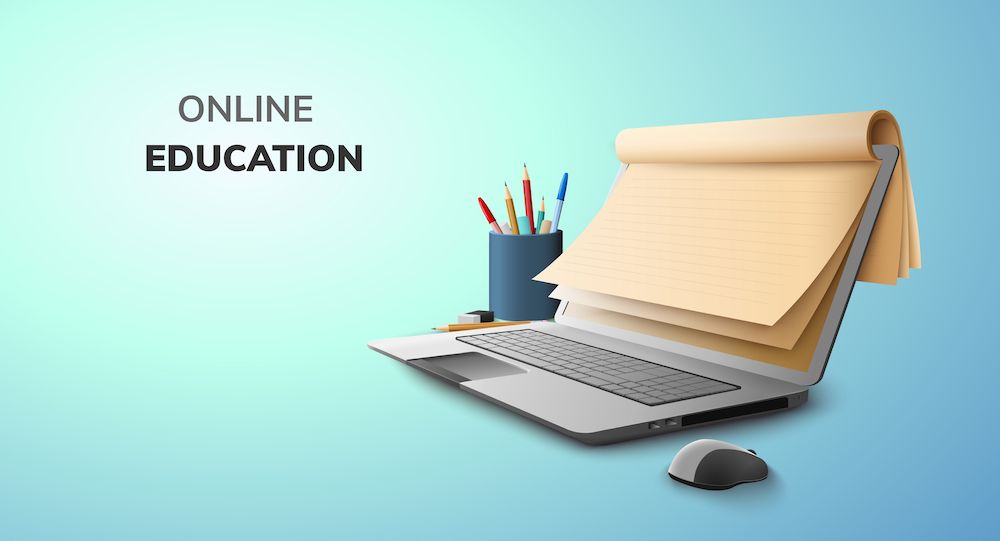
Wie ist das Dokument aufgebaut?
Der Artikel besteht aus zwölf Abschnitten, jeder ist einer Facette von Geld gewidmet und setzt sich jeweils zusammen aus einem knackig formulierten Text und einer Illustration, die dabei hilft, die Definition sicher abzuspeichern.
Wer hat dieses Dokument erarbeitet?
Jürg Conzett hat lange als Anlagestratege gearbeitet. Er hat die Sunflower Foundation gegründet und das dazugehörige MoneyMuseum in Zürich. Beide Einrichtungen beschäftigen sich mit Geld und Wirtschaft in all ihren Facetten und hinterfragen diese kritisch, um Lösungsansätze für aktuelle Probleme zu finden. Der Inhalt basiert auf den Forschungsarbeiten von Eske Bockelmann.

Schöne Stadtstrasse mit Läden, Hotels, Restaurants und tollen Angeboten ... allerdings nur gegen Geld. Was bedeutet dies, in einer solchen Stadt zu leben?
Schöne Stadtstrasse mit Läden, Hotels, Restaurants und tollen Angeboten ... allerdings nur gegen Geld. Was bedeutet dies, in einer solchen Stadt zu leben?
Um über das moderne Geld sprechen zu können, benötigen wir Begriffe. Sie beschreiben Geld von wirtschaftlicher, psychologischer und mentaler Perspektive.
wirtschaftliche Begriffe
1. Tauschmittel
Auf die Frage "Was ist Geld?" antworten die meisten: Geld ist ein Tauschmittel. Schauen wir uns diesen Begriff näher an. Geld ist ein universales Tauschmittel. Das heisst, mit diesem einen Tauschmittel ist all das zu kaufen, was wir zum Leben benötigen oder uns wünschen. Überlegen Sie einmal, was Sie sich tagtäglich ohne Geld beschaffen könnten hinzugedachte Wert ist der Tauschwert.
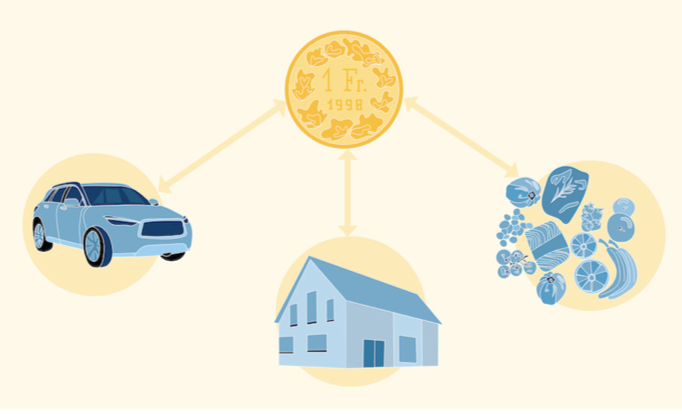
In jedem Land gibt es ein universelles Tauschmittel, mit dem alles gekauft und verkauft werden kann. Dies wird durch staatliche Vorschriften und Gewalt sowie das Geldmonopol garantiert. Geld ist keine Ware. Es dient sausschließlich dem Zweck, Waren zu kaufen. Es ist ein rein instrumentelles Mittel zum Tauschen. Auf der anderen Seite ist eine Ware kein Geld. Eine Ware ist ein nützliches Gut.
Geld ist ein reines Tauschmittel, das auf Waren zugreift und außerhalb der Realität der Waren existiert.
2. Tauschwert
Wir benutzen Geld normalerweise, um etwas zu kaufen. Dabei setzen wir den Wert eines Gegenstandes mit dem Geldwert gleich - das nennen wir Tauschwert. Diese Denkweise führt dazu, dass wir alle Dinge als Tauschwerte, also wie Geld, betrachten. Aber wo findet man diesen Wert in der Natur oder in den Dingen selbst? Tatsächlich existiert er nur in unseren Köpfen. Ohne diese "Wertbrille" würden wir Dinge anders sehen. Dann wird aus der Kuh als Produktionsmittel ein empfindsames Tier oder aus Arbeitskräften werden ganz unterschiedliche Menschen mit ihren besonderen Eigenschaften.
Geld wird nur als Tauschwert wahrgenommen. Waren und Dienstleistungen haben einen Tauschwert, aber sie sind auch einfach die Dinge, die sie sind, und verlieren ihren Tauschwert, sobald sie verbraucht werden. Durch die Gleichsetzung von Geld und Dingen behandeln wir die Dinge als Tauschwerte.

WERT ist die Brille, durch die wir die Welt sehen.

3. Wert
Modernes Geld, ob als Münze, Banknote oder Zahl auf einem Konto, bezeugt nur die Existenz einer bestimmten Menge Geldwert – sonst nichts. Dies im Gegensatz zu Gold- oder Silbermünzen, die ihre Materialeigenschaften besassen und als genormtes Gut in einen Kauf eingehen konnten. Geldwert ist eine Menge ohne eigene Substanz.

Geldwert besteht allein darin, als eine bestimmte Menge in konkrete Dinge eingetauscht zu werden. Geldwert ist ein leeres Bezugssystem, an dem die Waren wie an einem Massstab gemessen werden.
Damit hängen wir Menschen von etwas ab, das nicht als Ding existiert, sondern als Bezugssystem. Indem Menschen mit Geld auf all die existierenden Dinge zugreifen und über andere Menschen verfügen, existiert es. Würde diese Kette von Kaufhandlungen ausgesetzt, wären Zahlen auf dem Konto einfach Zahlen oder Geldscheine wären nutzloses Papier. Mit anderen Worten ohne die Menschen, die das Geld auf eine ganz bestimmte Weise handhaben, gibt es kein Geld.
Auf diese Art zu denken hat Descartes im 17. Jahrhundert als erster hingewiesen. Er beschrieb das Koordinatensystem mit den x, y und z Achsen, mit dem jeder Punkt im Raum beschrieben werden kann. Die Schweizerische Nationalbank erwähnt Descartes' Gedankenkonstrukt auf der Rückseite der 200-Franken-Note.
4. Nationalstaaten
Damit Geld, als reines Bezugssystem, funktioniert, müssen die Menschen es auf eine ganz bestimmte Weise handhaben. Dafür sorgen die Nationalstaaten, die ihre jeweiligen Landeswährungen als gesetzliches und alleiniges Zahlungsmittel festlegen und mittels Gesetzen, Gerichten, Polizei und wenn nötig mit Hilfe des Militärs die Einhaltung der Regeln durchsetzen. Denn die Nationalstaaten sind in ihrer Existenz ebenso abhängig vom Geld, wie es ihre Einwohnerinnen und Einwohner sind.

soziale und psychologische Begriffe
5. Eigentum
Etwas kostet etwas ist eine einfache Formel. Diese Formel lässt sich aber in der Natur nicht beobachten. Es ist ein Geschehen, das nur zwischen Menschen stattfindet.
Geld wird für etwas, aber immer an jemanden gezahlt. Über Geld stehen sich Menschen als Käufer und Verkäuferinnen gegenüber. Der eine gibt sein Geld gegen die Ware der anderen, die andere gibt ihre Ware gegen das Geld des einen.

Damit Menschen Ware gegen Geld tauschen können, müssen sie zuerst ausschliesslich darüber verfügen - sowohl über die Ware als auch über das Geld.
So treten sich Menschen als Eigentümer in einem sehr speziellen Verhältnis gegenüber. Was bedeutet diese besondere Art von Verhältnis in seiner Konsequenz?
6. Ausschluss
Damit Menschen für etwas, das sie brauchen oder sich wünschen, Geld bezahlen, müssen sie zuerst davon ausgeschlossen sein. Dieser Ausschluss ist zwingend notwendig, sonst verliert die Formel "etwas kostet etwas" ihre Gültigkeit.

Andersherum betrachtet braucht das Geld den Geldmangel. Nur wo es auch jemandem fehlt, entsteht der fürs Funktionieren notwendige Ausschluss.
Geld verwehrt den Zugang zu allen Gütern, damit nur Geld ihn verschaffen kann.
All die Dinge, die es wirklich gibt, stehen nur da zur Verfügung, wo das Geld dafür vorhanden ist. Ohne Geld stehen sie nicht zur Verfügung, obwohl es sie gibt. Umgekehrt finden nur diejenigen Waren Verwendung, die einen Käufer finden. Waren, die keinen Käufer finden, werden vernichtet.
Bei denjenigen, die kein Geld haben, erzeugt Geld Mangel.
Bei denjenigen, die Geld haben, erzeugt Geld Überfluss.
7. Verfügungsmacht
Geld zwingt Menschen dazu, etwas zu leisten, wofür andere Geld bezahlen. Denn zu Geld kommt jede:r ausschliesslich durch andere Menschen. In der Regel verkaufen Menschen nicht was sie haben, sondern was sie leisten oder herstellen.
Für Geld ist jeder und jede gezwungen, andere über sich und seine Arbeit verfügen zu lassen, um mit Geld seinerseits über andere und deren Arbeit verfügen zu können. Überlegen Sie, wie viele Leute an einem ganz gewöhnlichen Tag für Sie gearbeitet haben. Vergessen Sie nicht, die Leute mitzuzählen, die dafür gesorgt haben, dass der Reis für Ihr Mittagessen auf dem Feld in Norditalien gewachsen ist, geerntet, gereinigt, verpackt wurde etc.

8. Konkurrenz
Wer Geld braucht, braucht dasselbe wie alle anderen - von anderen - für sich. Um von jemandem Geld zu bekommen, muss er sich an jemanden wenden, bei dem andere dasselbe versuchen.
Durch Geld treten alle zueinander in Konkurrenz: um das Geld anderer, gegen die anderen und jeder und jede für sich.

Angetrieben wird die Konkurrenz durch die notwendig entgegengesetzten Interessen von Käufer. Die Käuferin versucht Ware für möglichst wenig Geld zu bekommen, der Verkäufer versucht für seine Ware möglichst viel Geld zu erhalten.
Die Konkurrenz um Geld vollzieht sich zwischen den einzelnen Menschen, die sich auf dem Markt - so nennt man dieses Konkurrieren - behaupten müssen.
Das geschieht zwischen Berufsständen, Unternehmen, zwischen Gemeinden, Städten, Regionen, Staaten und Staatenblöcken.
Für alle gilt, im Zugriff auf andere und in Konkurrenz zu anderen für sich zu Geld zu kommen.
mentale Begriffe
9. Kredit
credere … glauben
Weil Geld selbst aus nichts besteht, kann es nur als Kredit geschöpft werden, kursiert es als Kredit, besteht es als Kredit.
Der Wert des modernen Geldes liegt nicht im Geld selbst, sondern im Zugriff auf die Dinge, die für die Menschen von Bedeutung sind. Es ist wie das Gold, das noch im Boden liegt, auf das Mephisto in Goethes Faust verweist, als er dem König das «Zeichengeld» vorschlägt. Das Zeichengeld stellt einen Anspruch auf zukünftige Werte dar. In diesem Sinn ist Geld als einzulösender Kredit angelegt. Das hat zur Folge, dass die Ketten von Kaufhandlungen so lange nicht abbrechen dürfen, als das Geld als solches bestehen soll. Einmal in Gang gekommen, verlangt diese Dynamik danach, zurückgezahlte Kredite sogleich durch neue zu ersetzen, damit der Zugriff auf benötigte Dinge gewährleistet bleibt.

10. Finanzwirtschaft
Kreditbasiertes Geld und dessen systembedingte Wachstumsdynamik erfordert einen exponentiell ansteigenden Bedarf an Mehrwert (Gewinne). Die in einer endlichen Welt vorhandenen Ressourcen können diesen Bedarf niemals decken. Deshalb kommt es zur Expansion in die Finanzwirtschaft. Denn ein Geldgewinn durch Waren, der erst für später erwartet wird, lässt sich in Form von Wertpapieren vorwegnehmen. Der Wert dieser Papiere steigt oder fällt mit der Höhe der Gewinnerwartung. Jeder Wert, den ein Papier auf diese Weise darstellt, kann jeweils wieder zum Gegenstand einer Gewinnerwartung werden – in einem weiteren, derivierten Finanztitel (lateinisch derivare = ableiten). So potenziert sich der ursprünglich erwartete Geldgewinn immer weiter.
Letztlich bleiben jedoch all diese Papiere an die Einlösung der ursprünglichen Gewinnerwartung gebunden. Fällt diese weg, lösen sich alle darauf bezogenen verbrieften «Werte» in Luft auf.

11. Wachstum
Seit Geld als universales Zahlungsmittel gilt und unser Lebensunterhalt vom Geld abhängig ist, müssen wir alle schauen, dass wir letztlich mehr Geld haben, als wir für dessen Beschaffung aufgewendet haben.
Erst mit diesem Mehr an Geld können wir all die Dinge kaufen, die wir zum Leben brauchen.

Egal von wem Geschäfte gemacht werden oder womit, ob von Einzelnen, Unternehmen oder Konzernen, ob mit der Herstellung von Waren, mit Handel oder irgendetwas sonst: Wo Geschäfte nicht genug Geld einbringen, müssen sie unterbleiben - durch Aufgabe, Verzicht oder Pleite.
Die Vermehrung von Geld gelingt:
- durch die aktive Ausweitung des Raumes, in dem Menschen gezwungen werden, von Geld zu leben (zuerst im westlichen Europa, dann in den Kolonien und heute auf der ganzen Welt),
- durch immer mehr Dinge, die zu Waren gemacht werden; durch die Notwendigkeit, Anschaffungen in immer kürzeren Abständen zu machen; durch kürzere Haltbarkeit usw.
- durch die Bezahlung von Menschen dafür, dass sie arbeiten zur Herstellung von Waren oder Leistungen von Diensten, deren Verkauf mehr Geldwert einbringt, als für die Arbeitskraft bezahlt wird.
In einer Wirtschaft, die über Geld läuft, ist Wachstum nicht Ergebnis von Gier, sondern eine Notwendigkeit.
Eske Bockelmann erklärt die unabdingbare Notwendigkeit von Wachstum in einer geldbasierten Wirtschaft.
12. Denkreflex
Geld wirkt sich auf unser Denken aus, darauf wie wir die Welt sehen, und es ist schwer zu greifen, weil wir in der Regel mit genau dieser Sichtweise auch über Geld nachdenken.
Da Geldwert keine Substanz hat, ist er grundsätzlich eine bloss gedachte Grösse: etwas, das alle, die mit Geld umgehen, notwendig in ihrem Denken nachvollziehen und leisten müssen.
Mit dem Geld wird es nicht nur nötig, sondern alltäglich, all die Dinge und Erscheinungen in quantitativer Form zu denken. Denn alles in der Welt, dem ein Geldwert zugedacht wird, wird damit als Geldwert gedacht - als reines Quantum.
Je stärker die Abhängigkeit der Menschen vom Geld wird, desto stärker wird der Reflex, alles als quantifizierbar anzusehen, weit über die Gelegenheiten hinaus, bei denen es um Geld und um Kaufen geht.
Beispiele: Katastrophenberichte, die vor allem aus Opferzahlen, Schadenssummen bestehen; Schmerz und Lust werden als negative und positive Werte auf einer Skala der Empfindungen abgebildet; Kompensation für Landnahme in Prozenten von der genommenen Fläche zur Gesamtfläche, ohne die Bedeutung für die betroffene Bevölkerung in Betracht zu ziehen.
Und weil Geld reines Quantum ist, verlangt es uns eine ganz besondere Art der Abstraktion ab.
Es bringt uns dazu in Ausschliessungs-Verhältnissen zu denken: Ware ist nicht Geld und Geld ist nicht Ware und doch bedingen beide einander.
Diese Art von „in Beziehung setzen“ hat Aldo Häsler so umschrieben: „Geld verbindet, indem es trennt.“ Es handelt sich um dieselbe Abstraktionsleistung, welche Eske Bockelmann in seinem Buch „Im Takt des Geldes“ herausgearbeitet hat und die er als funktionales Denken bezeichnet, das reflexartig unsere Wahrnehmung beeinflusst. Sie führt z.B. dazu, dass wir uns selbst als eigenständige Individuen und die Welt als Umwelt sehen.
Jedes Ding, jedes Wesen, jede Tätigkeit, jede Empfindung, alles in der Welt hat seinen besonderen Inhalt, seine Eigenschaften - ausser Geld. Alles das aber, mit all seinem besonderen Inhalt, denken und behandeln Menschen zugleich als etwas ohne jeden Inhalt - durch Geld.
Eske Bockelmann erklärt das funktionale Denken und den Denkreflex.

