Das lange 16. Jahrhundert

Man spricht vom langen 16. Jahrhundert, weil die damaligen Umwälzungen und Auswirkungen weit ins nachfolgende Jahrhundert reichen und deren Ursprünge weit vor 1500 liegen. Diese Phase offenbart Änderungen, die für die Geschichte des Geldes von grosser Bedeutung sind.
Im 16. Jahrhundert beschleunigte sich die Landflucht und das Erstarken der bürgerlichen Gesellschaft. Es fand ein Wandel des Weltbildes statt.
An was ist ersichtlich, dass unser modernes Geld entstanden ist? Wir schauen uns dazu folgende Dokumente an:
- das Volksbuch Fortunatus von 1509
- die Jesuitenschule von Salamanca
- die Aussagen des Ökonomen Misselden 1622
- und die Beschreibung des Rhythmus als Taktrhythmus durch Descartes 1618.
Fortunatus, ein Volksbuch, 1509
Anfangs des 16. Jahrhunderts beginnt die Verbreitung des Fortunatus als eines jener „Volksbücher“, wie die Romantiker sie später getauft haben, da kein Verfasser angegeben war. Zu diesen „Volksbüchern“ zählen auch Berühmtheiten wie der Eulenspiegel und das Buch von Doktor Faustus. In ganz Europa ist der Fortunatus präsent und über 200 Jahre lang findet dort die Geschichte vom nie versiegenden Portemonnaie viele Leser. Erstausgabe war 1509.
Fortunatus Vater konnte seinen Lebensstil im Feudalwesen nicht mehr halten; es war die Zeit des Zerfalls des Feudalsystems. Der Sohn musste sein Glück in fernen Landen suchen. Sein Versuch zu Geld zu kommen, scheiterte. In tiefster Nacht, sinnbildlich für Verzweiflung, trifft er auf die Göttin Fortuna: er könne wählen zwischen Weisheit, langem Leben oder Geld. Er entschied sich sofort für das letztere und erhielt einen Säckel mit nie versiegenden Münzen drin.
Was macht nun Fortunatus mit seinem neuen Reichtum? Er ist sich der Wirkung seines Kapitals nicht bewusst. Als Erstes geht er in ein Wirtshaus und lässt sich gut bedienen. Er will Pferde kaufen, und der Wirt zeigt ihm drei wertvolle Rappen. Als Fortunatus einen lokalen Grafen für diese drei kostbaren Pferde überbietet (4. Bild von oben), lässt dieser ihn ins Gefängnis werfen. Er habe wohl das Geld gestohlen, und Rechtshoheit übt der Graf aus. Das kostet ihn fast das Leben.
Fortunatus übersah die vorherrschenden Gesellschafts-Ordnung. Seine Lehre: Ihm wird klar, dass er fortan sein Leben auf einer Lüge aufbauen muss, denn er darf das Geheimnis des «nie versiegenden Säckels» niemandem anvertrauen, nicht mal seiner zukünftigen Ehefrau. Fortunatus beobachtet sorgsam, wie Edelleute sich benehmen (5. Bild von oben). Er legt sich behutsam eine Identität zu, indem er sich einen Knecht und zwei Pferde anschafft. Auch als er später in seine Heimatstadt zurückkehrt und sich einen Palast baut, muss er sich die Identität eines Adligen konstruieren. Denn Bargeld allein hätte den Argwohn der Gesellschaft geweckt. So erwirbt er Hof und Gut eines verarmten Grafen und verfügt damit auch über Leute, so wie es sich für Adlige gehört.
Heute spricht man von Identität, die sich jeder in der geldvermittelten Gesellschaft erwerben muss. Dazu ein kurzes Video von Eske Bockelmann über Geld und Beziehung.
Fortunatus war 1509 noch im höfischen Milieu angesiedelt. 1556 erschien der Roman Von guten und bösen Nachbarn von Georg Wickram, der bereits ausschliesslich Ereignisse aus dem bürgerlichen Leben zeigt. Das ist ein grosser Unterschied. Auffallend ist der wirtschaftliche Eifer. Das Streben nach Geldgewinnen wurde dominant, die Personen in Wickrams Roman stellen Leute ein, die für sie arbeiten und zum Geldreichtum des Unternehmers beitragen. Typisch ist auch die Allianzen zwischen zwei Unternehmer-Familien durch Heirat, um die Kapitalbasis und die Marktstellung des Unternehmens zu festigen.
Das Arbeiten erfolgt nicht in erster Linie, um den Lebensstandard zu steigern. Das Gewinnstreben erfährt seine Legitimation durch das Ziel, Gott wohlgefällig zu sein und seinen Ruhm zu mehren. Dieser rasante Wandel im Volksempfinden ist bemerkenswert.
Holzschnitt-Bebilderung und Kapitelüberschriften aus der Buchausgabe von 1509:

Wie Fortunatus ohne Wissen seines Vaters und seiner Mutter mit dem Grafen von Flandern aus dem Land Zypern hinwegfuhr.
Wie Fortunatus ohne Wissen seines Vaters und seiner Mutter mit dem Grafen von Flandern aus dem Land Zypern hinwegfuhr.

Wie Fortunatus sich in einem Wald verirrte, dort übernachtete und in grosses Elend und in Sorge um sein Leben kam.
Wie Fortunatus sich in einem Wald verirrte, dort übernachtete und in grosses Elend und in Sorge um sein Leben kam.
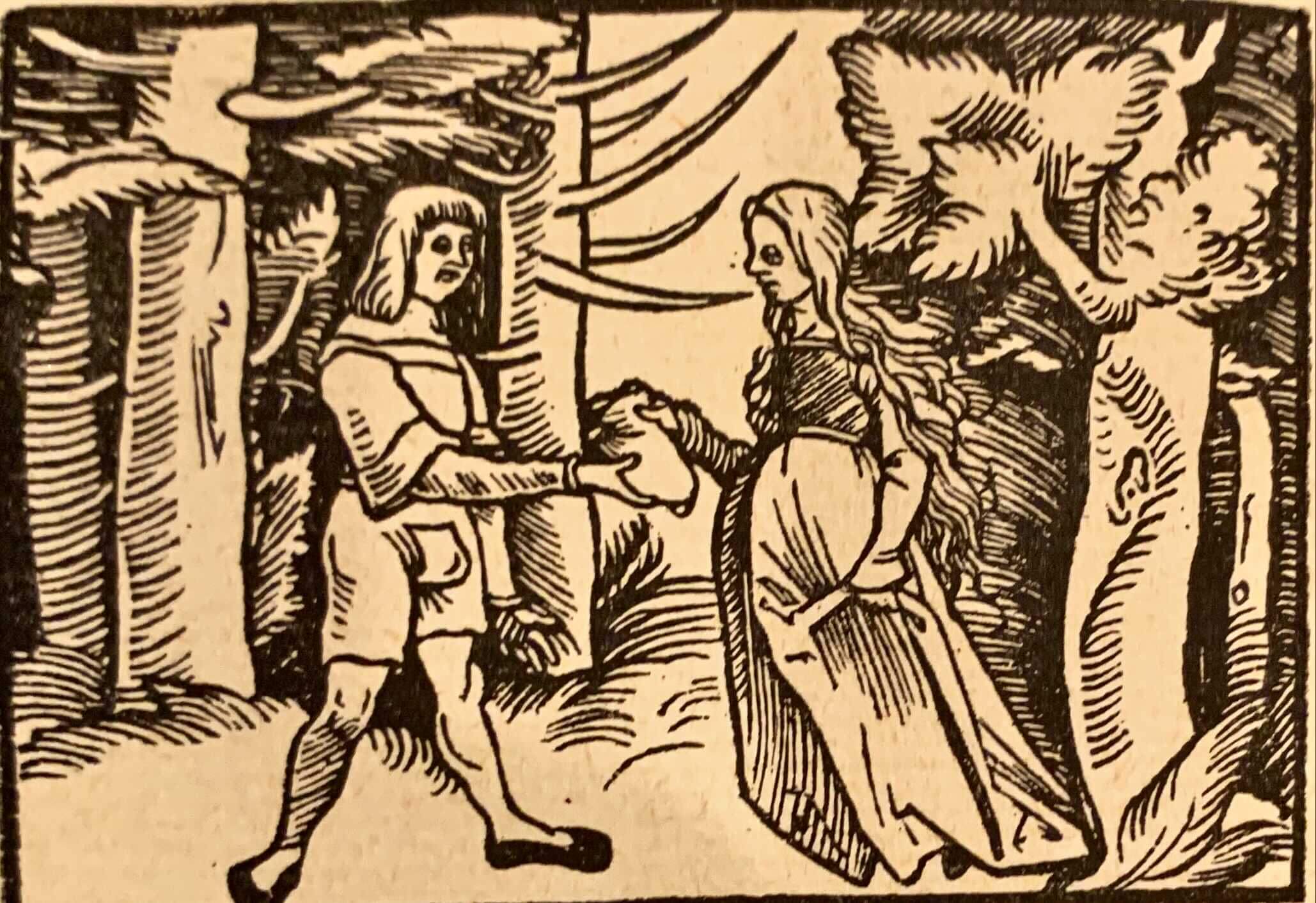
Wie die Jungfrau, die über das Glück gewaltig ist, Fortunatus einen Säckel schenkte, dem nimmer das Geld ausging.
Wie die Jungfrau, die über das Glück gewaltig ist, Fortunatus einen Säckel schenkte, dem nimmer das Geld ausging.
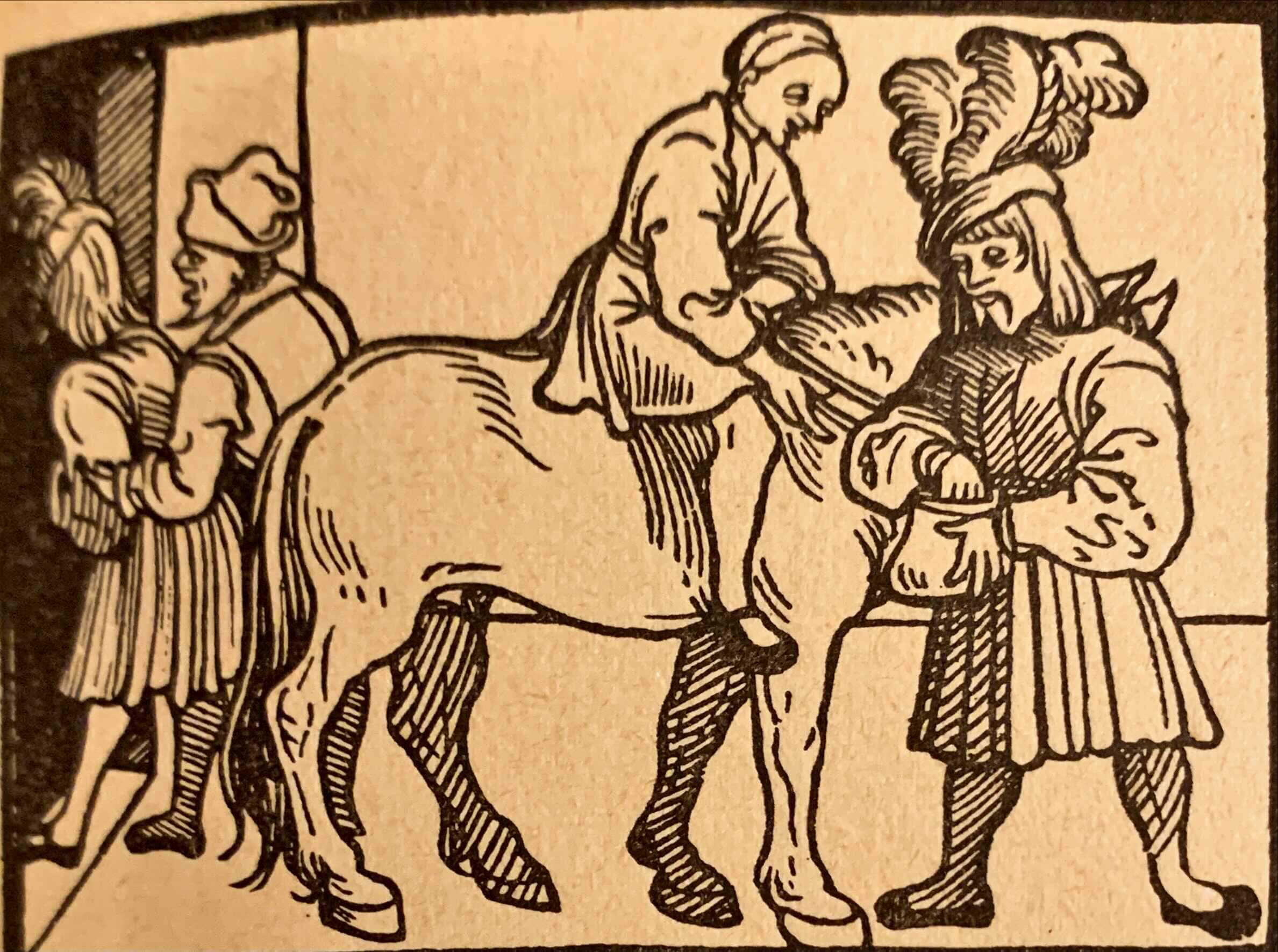
Wie Fortunatus dem Waldgrafen etliche Pferde vor der Nase wegkaufte, weshalb er gefangen wurde und in grosse Not und Angst kam.
Wie Fortunatus dem Waldgrafen etliche Pferde vor der Nase wegkaufte, weshalb er gefangen wurde und in grosse Not und Angst kam.

Wie Fortunatus nach Nantes in die Bretagne kam ... und einen Diener aufnahm, der weit herumgekommen war und viele Länder gesehen hatte.
Wie Fortunatus nach Nantes in die Bretagne kam ... und einen Diener aufnahm, der weit herumgekommen war und viele Länder gesehen hatte.

Wie Fortunatus wieder nach Venedig kam und von dort nach dem fernen Konstantinopel fuhr.
Wie Fortunatus wieder nach Venedig kam und von dort nach dem fernen Konstantinopel fuhr.

Wie Fortunatus wieder nach Cypern kam, wo er sich in allen Dingen überaus klug verhielt und sich einen kostbaren Palast baute.
Wie Fortunatus wieder nach Cypern kam, wo er sich in allen Dingen überaus klug verhielt und sich einen kostbaren Palast baute.

Wie Fortunatus starb, seine beiden Söhne an das Totenbett berief und wie er ihnen die Kraft und die Tugend des Glückssäckels und des Wunschhütleins offenbarte.
Wie Fortunatus starb, seine beiden Söhne an das Totenbett berief und wie er ihnen die Kraft und die Tugend des Glückssäckels und des Wunschhütleins offenbarte.
Die Jesuiten von Salamanca:
Bedeutung erlangte die Schule von Salamanca durch die Entwicklung eines „internationalen Naturrechts“. Vor dem Hintergrund der Eroberung in Süd- und Mittelamerika durch Spanier und Portugiesen, des Humanismus und der Reformation gerieten die traditionellen Konzeptionen der römisch-katholischen Kirche im 16. Jahrhundert zunehmend unter Druck. Die Schule von Salamanca nahm die sich daraus ergebenden Probleme in Angriff. Ihr Ziel war die Harmonisierung der Lehren Thomas von Aquins mit der neuen ökonomisch-politischen Ordnung der Zeit.
Die Theorien der Schule von Salamanca läuteten das Ende des mittelalterlichen Rechtskonzepts ein. In einem für das Europa der damaligen Zeit unüblichem Masse fordern sie mehr Freiheitlichkeit. Die natürlichen Rechte des Menschen (Recht auf Leben, Recht auf Privateigentum, Meinungsfreiheit, menschliche Würde) wurden zum Mittelpunkt des Interesses der Schule von Salamanca. Diego de Covarrubias y Leiva (1512–1577) zufolge haben Menschen nicht nur das Recht auf Privateigentum, sondern auch das Recht, exklusiv aus den Vorteilen des Eigentums zu profitieren.
Edward Misselden: "Free Trade, Or the means to make trade flourish", 1622.
Misselden war Direktor der East India Company und wirtschaftlicher Berater des englischen Königs. „Geld ist jetzt zum Preis für alle Dinge geworden“, schreibt Misselden 1622. Zum ersten Mal ist diese Aussage nachweisbar, Geld ist jetzt feststellbar. Er schreibt: „Was seine Natur und was die zeitliche Abfolge betrifft, kommt Geld erst nach der Ware, doch so, wie es heute in Gebrauch ist, wurde es die Hauptsache“. Dies entspricht unserer modernen Auffassung von Geld.
Englischer Text auf Internet abrufbar. Link unten
Descartes:
Descartes verfasst 1618 ein Buch über Musik, beschreibt die Noten, den Rhythmus. Zum ersten Mal benutzt er die Bezeichnung "Taktrhythmus" zur Beschreibung des Rhythmus. Das ist erstaunlich. Etwas muss sich im Kopf der Menschen von damals verändert haben. Nur 50 Jahre vorher fühlten sie noch einen andern Rhythmus.
Descartes schreibt:
Das Zeitmass der Töne muss aus gleichen Teilen bestehen, weil diese vom Sinn am leichtesten vom Gehör erfasst werden ... Diese Einteilung wird markiert durch einen Schlag oder den sog. Niederschlag, was zur Unterstützung unserer Einbildungskraft geschieht … wie die Kriegstrommel, bei der nichts als das Zeitmass gehört wird …
Woher kommt dieser Wandel? Jahrhunderte musste die Antwort warten, bis Eske Bockelmann den Faden aufnahm und akribisch genau nachweist, woher dieser Wandel, dieser unbewusste Reflex in der Rhythmuswahrnehmung herkommt. Er verfasst das Werk "Im Takt des Geldes".
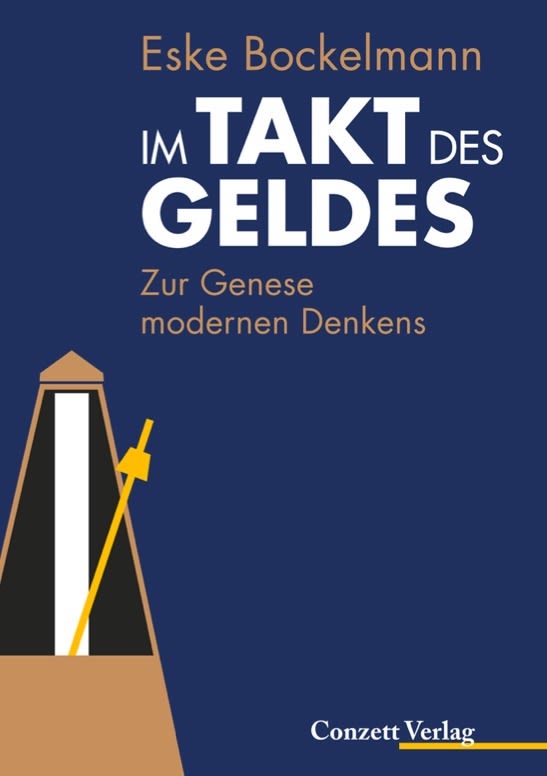
Eske Bockelmann, Im Takt des Geldes, 2004
Eske Bockelmann, Im Takt des Geldes, 2004
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, ergibt sich zum ersten Mal, was vorher undenkbar war und auch keinen Grund gehabt hätte: dass die europäischen Mächte fast gesamt gegeneinander zu Felde ziehen.
Ein Konflikt war von solch flächenhafter Ausbreitung, dass er als der erste Weltkrieg Europas bezeichnet werden kann. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 (Prager Fenstersturz) bis 1648 (Westphälischer Frieden) war ein Konflikt um die Hegemonie im Heiligen Römischen Reich und in Europa; er begann als Religionskrieg und endete als Territorialkrieg.
Der 30 jährige Krieg von „musstewissen Geschichte“:
Flugblatt
zum Westfälischen Frieden 1648

Nach einem Krieg, der seit 1620 tobte, wird jetzt der Friede gefeiert, weil dank ihm die Geschäfte wieder laufen werden. Das Wohlergehen, das er verspricht, besteht jetzt darin, dass alle wieder zu Geld kommen. Uns leuchtet heute selbstverständlich nichts eher ein, als dass gute Zeiten genau das versprechen. Genau das jedoch ist neu. Nur wenige Jahrzehnte vor diesem Krieg hatte es sich damit noch nicht so verhalten und hatte es sich noch nie und nirgends so verhalten. Erst jetzt steht im Mittelpunkt jeder Hoffnung auf Wohlergehen nicht mehr etwas wie die alte Ordnung der Stände, von welcher die Versorgung aller abhing, sondern das Geld, von dem man nunmehr lebt.
Nach einem Krieg, der seit 1620 tobte, wird jetzt der Friede gefeiert, weil dank ihm die Geschäfte wieder laufen werden. Das Wohlergehen, das er verspricht, besteht jetzt darin, dass alle wieder zu Geld kommen. Uns leuchtet heute selbstverständlich nichts eher ein, als dass gute Zeiten genau das versprechen. Genau das jedoch ist neu. Nur wenige Jahrzehnte vor diesem Krieg hatte es sich damit noch nicht so verhalten und hatte es sich noch nie und nirgends so verhalten. Erst jetzt steht im Mittelpunkt jeder Hoffnung auf Wohlergehen nicht mehr etwas wie die alte Ordnung der Stände, von welcher die Versorgung aller abhing, sondern das Geld, von dem man nunmehr lebt.
Lesenswert ist die Analyse dieses Flugblattes von Eske Bockelmann.
Das musst Du wissen:
- Anzeichen des modernen Geldes häufen sich im 16. Jahrhundert.
- Das Volksbuch Fortunatus zeigt, dass der neue Reichtum anders war als das Kaufmannskapital. Das neue Geld zwang diese Personen, ihr Leben auf einer Lüge aufzubauen, die sie heute ihre Identität nennen.
- Der Roman Von guten und bösen Nachbarn, nur 50 Jahre nach Fortunatus publiziert, handelt bereits vom bürgerlichen Milieu. Auffallend ist der wirtschaftliche Eifer. Später wird Max Weber schreiben, dass der Schritt zum modernen Kapitalismus vor allem von der aufstrebenden Mittelschicht vollzogen wurde.
- Die Jesuiten von Salamanca erarbeiteten die kirchliche Grundlage für den privaten Gebrauch von Eigentum, eine Grundvoraussetzung für eine geldvermittelte Gesellschaft.
- Von Edward Misselden, Merkantilist, stammt der Ausspruch von 1622: Geld ist jetzt zum Preis für alle Dinge geworden.
- Descartes stellt 1618 fest, dass Rhythmus in Musik und Literatur Schlag- oder Taktrhythmus ist - allerdings noch ohne zu erklären, woher dieser Wahrnehmungswandel stammt.
- Ein Flugblatt von 1648 zeigt Merkur und verspricht Wohlergehen, dass alle wieder zu Geld kommen. Das signalisierte den Abschluss des Wandels zum modernen Geld.

